Jahresende 1957. Am Abend notiert Henry: Ausnahmsweise mal wieder nette Leute gesehen. Beim Konzert im Klub. Ein Orchester brachte uns die 9. Sinfonie von Beethoven in die Wildnis. Augenblicke des Vergessens und der Hoffnung. Und jetzt will ich essen. Neulich sagte mein Zimmerkumpel, Leutnant Ko., zu mir: „Wenn es so einfach wäre, dass Frieden überall auf der Welt allein von mir abhinge, dann würde ich dafür mein Leben geben.“ Seine Worte sind ganz ehrlich gemeint, gehen mir zu Herzen. Und was brachte das Jahr mir? Dazu blättere ich in meinem Taschenkalender der NVA und schaue mir die Notizen an: Meine Bücher: sechs Bände Heine, drei Bände Goethe, 1. Band „Zur deutschen Geschichte“ von Engels, „Der Finanzier“ von Th. Dreiser, „Junggesellenwirtschaft“ (Balzac), „Ein Held unserer Zeit“ (Lermontow), „Stärker wie der Tod“ (Maupassant), „Rot und Schwarz“ und „Über die Liebe“ (Stendhal), „Lehrjahre des Gefühls“ (Flaubert), „Shakespeare Gestalten“ und andere. 15. Februar: Faschingsabend mit der DAKO. Cleo kennengelernt. Vom 16. bis 30. September Prüfungen an der Offiziersschule. 18. Oktober: Mit Marlis und Ute in „Hoffmanns Erzählungen“. 19. Oktober: Film „La Strada“ gesehen. Ende des Urlaubs in Leipzig. Auf Seite 91 des ersten Kalenders der NVA ein Foto mit folgender Unterschrift: „Garmisch-Partenkirchen; heute noch Tummelplatz amerikanischer Besatzer. In einem wiedervereinigten Deutschland Erholungszentrum der Werktätigen.“ Diesen Kalender werde ich mir aufheben.
Im Kinosaal des Regimentes. Alle Offiziere sind versammelt. Vor sich die VS-Bücher (Geheime Verschlusssachen), die nur für dienstliche Aufgaben vorgesehen sind. Aber so toll ist das Gesagte dann doch nicht. Informiert werden die Vorgesetzten nämlich über einen Beschluss des Politbüros vom 14.1.1958. Es geht darum, eigene Vorstellungen über die Einheit von politischer und militärischer Führung, sprich Einzelleitung, zu entwickeln. (Der Hintergrund, den aber kaum jemand kennt: Man will nicht den Praktiken in der Sowjetarmee folgen; Offiziere sind schließlich keine gesonderte „Klasse“, die wie Alleinherrscher schalten und walten können, die DDR ist gegen die Anmaßungen der vielen „kleinen Shukows“, gegen Überheblichkeit und Selbstherrlichkeit, gegen zunehmenden „Bonapartismus“, wie Jahrzehnte später nach 1989 in dem Buch „Rührt euch! Zur Geschichte der NVA“, Seite 421, nachzulesen sein wird.) Also haben sich die Kommandeure mehr auf das Kollektiv zu orientieren, heißt es, auch sollen sie die Meinung des jeweiligen Politstellvertreters einholen, wenn es die Umstände erlauben. Henry und die anderen Offiziere nehmen das mit Verständnis zur Kenntnis, sie sind schließlich eine sozialistische Armee – aber was das für jeden Vorgesetzten bedeuten würde, für sein menschliches und politisches Urteilsvermögen, für seine Charakterbildung, das sollte sich als große Herausforderung erweisen. dass das der springende Punkt war, der sehr wunde, der immer wieder zu Auseinandersetzungen führte mit arroganten Leuten, mit Nichtkönnern – das hat Henry in den folgenden über dreißig Jahren in der Armee immer wieder persönlich erlebt.
Henry freut sich immer über Post, sind Briefe doch Lebenszeichen von außen nach innen und hellen den Alltag gehörig auf. Diesmal bekommt er einen Brief von Heinz St., einem prima Kerl und Zughelfer von der Offiziersschule: „Wie ich Dir auf der Karte andeutete, habe ich in der Ausbildung Pech gehabt. Aus meinem Zug ist mir einer angeschossen worden, war ja allerhand los, und wie es so ist, hat der jeweilige Offizier die Verantwortung. Ich bin ganz schön fertig, seelisch und moralisch. (…) Ansonsten habe ich dienstlich gesehen keine Schwierigkeiten, ich komme mit allen Kommandeuren gut aus. Habe auch ausgezeichnete Beurteilungen bekommen zu dem Fall. Bin jetzt nur noch gespannt, was für eine Bestrafung ich mir einhandeln werde. Mit der Freizeit sieht es äußerst flau aus. (…) Meine Funktionen sind bis jetzt Zugführer, FDJ-Sekretär, Zirkelleiter, Besprechungsleiter und verantwortlich für unsere Musikgruppe.“
Doch was ist ein Brief eines Freundes gegen den von Cleo? Ihre Schrift erkennt er von weitem, wenn der Hauptfeldwebel der Kompanie die Post geholt hat. Dann fängt Henry innerlich an zu zittern, so spannend ist es für ihn. Aber die Briefe sofort zu öffnen, das fällt ihm nicht ein. Nein, er wartet bis zum Abend. Legt sich nach dem Abendessen aufs Bett, schaltet leise Musik ein und das Nachttischlämpchen, schaut, dass ihn niemand stört und liest ganz langsam, jedes Wort abtastend, ja, genießend: „Gestern kam Dein Glückwunsch. Du kannst mir glauben, dass Du mir eine große Freude damit gemacht hast, erstens weil es unerwartet kam und zweitens etwas besonderes war. Du bist eben ein sehr aufmerksamer und vornehmer Mann, das hast Du Deinen gleichaltrigen Genossen voraus. Ansonsten bist Du also noch in Pinnow und nicht vor Langeweile gestorben? Wie Du weißt, war ich zur Prüfung in Berlin. Ich kann nur sagen, dass es einfach toll war. 1. habe ich 3 Tage lang 150,-Mark gebraucht, jetzt bin ich vollkommen blank. Berlin ist eben furchtbar teuer, aber herrlich. Dort müsste man wohnen. Du kennst ja Berlin, Henry? 2. An der Schule dort sind den früh 67 Personen geprüft worden, davon sind 10 in die engere Auswahl gekommen. Unter den zehn war ich auch. Von den zehn haben sie dann drei Jungen und zwei Mädchen genommen. Leider war ich nicht dabei. Man muss eben direkt an der Quelle sitzen und Beziehungen haben. Die zwei, die sie genommen haben, waren nämlich Schülerinnen der Helene Weigel. Aber ich war trotzdem gut, wie die Kommission sagte. Nun ja, geht eben wieder von vorne los, mal wird es schon klappen.“
In einem weiteren Brief heißt es: „Ich will mich unbedingt bedanken für das wunderbare Geburtstagsgeschenk. Henry, stell Dir vor, ich hatte nämlich noch gar keinen Geburtstag. Du hast Dich um einen ganzen Monat versehen, ich habe nicht am 14. März, sondern am 14. April Geburtstag. Ich muss Dir schildern, wie Dein Fleurop-Geschenk kam. Ich wollte eben mit Jutta ins Theater gehen, stand im Unterrock im Flur, plötzlich klingelt es. Ich rufe ‚Moment, ich muss erstmal ein Kleid anziehen‘, natürlich hat man vor der Tür gelacht. Weißt Du, was ich bekommen habe? 6 große Stengel weißen Flieder von Dir. Henry, ich habe mich wirklich so gefreut, dass ich kurz vor halb acht erst fortgekommen bin und gerade so im Dunkeln noch durch die Reihe schleichen konnte. Henry, ich kenne mich nicht aus, aber der Flieder muss Dich doch sehr viel gekostet haben. Bin ich denn das Dir wert?“ Und ein anderes Mal meint Cleo: „Du beschäftigst Dich viel mit Büchern, das ist gut. Ich habe mir jetzt eine Kleist-Kassette bestellt, muss 4x monatlich 10 DM abbezahlen. Wenn ich das abbezahlt habe, lege ich mir noch die Klassikerkassette mit Goethe-Schiller-Lessing und Herder zu. Ich kann das gut für meine Weiterarbeit verwenden. Das Ihr nach Leipzig zieht, ist toll, es war ja schon immer Deine Wunschstadt, mir persönlich auch am sympathischsten von allen DDR-Städten.“
Früh 3.40 Uhr. Nachtwache. Blick aus dem Fenster in die dunkle Ebene. Stumm und dunkel heben sich die langen Kiefernstämme gegen den sich erhellenden Horizont ab. Erste Vogellaute. Die Luft ist frisch und rein. Vor Tagen hatte der junge Zugführer die Paradetage in Berlin noch einmal Revue passieren lassen. Diesmal war er nicht zu Fuß auf dem Marx-Engels-Platz, sondern per Schützenpanzerwagen. Erneut hatte ihn die Parade stark innerlich bewegt. Und so schrieb er denn ein „Gedicht“, eine „Ballade“, wie er sein vermeintliches Kunstwerk nannte und sandte es an die Wochenzeitung „Volksarmee“. Mal sehen, was die antwortet …
Die ließ nicht lange auf sich warten und holte ihn vom hohen Pferd wieder auf den Boden zurück: „Werter Genosse Popow! Wir erhielten Ihren Brief mit dem Gedicht ‚Parade‘, worin Sie uns um ein Urteil über Ihre Arbeit baten. Zunächst einmal verrät jede Zeile, dass ihr Verfasser mit dem Herzen bei der Sache war und das ist gut. Weniger gut ist es natürlich, eine ‚Schnelldichtung‘ – Sie schrieben diese Zeilen in zehn Minuten – nicht mehr zu überarbeiten. (…) Unser unvergessener Peter Nell sagte einmal: ‚Warum denn gleich Gedichte, sag’s lieber mit einer Geschichte!‘ Mit sozialistischem Gruß! …“
.
Zum Inhalt
Ausgangssituation ist Schweden und das Haus, in dem die Popows wohnen. Der Leser erfährt zunächst, wer die Eltern waren (seine Mutter stammt aus Moskau), berichtet kurz vom Evakuierungsort 1943/44 in Pommern, von der Rückkehr in das noch unter Bombenhagel liegende Berlin (Schöneberg), von den Eindrücken nach Kriegsende und vom Einleben in der neuen Gesellschaft, dabei auch von einer Begegnung der Jungen Pioniere mit Wilhelm Pieck.
Die Lehrzeit wird skizziert mit der Arbeit im Zwickauer Steinkohlenrevier, mit Tätigkeiten in der Geologischen Kommission der DDR und mit dem Besuch der Offiziersschule der KVP/NVA in Erfurt und in Plauen, wo er seine spätere Frau kennenlernte.
Wie lebt ein junger Offizier in der Einöde im Nordosten der DDR, welche Gedanken und Gefühle bewegen ihn? Darum geht es in den nächsten Aufzeichnungen seiner Impressionen. Seine Träume führen ihn mitunter weg vom Kasernenalltag und so nimmt er die Gelegenheit wahr, für fünf Monate im Walz- und Stahlwerk Eisenhüttenstadt als einfacher Arbeiter tätig zu sein.
Durch Versetzungen gelangt er nach Potsdam. Dabei kommen Querelen des Alltags als Ausbilder und später als Politoffizier nicht zu kurz. Ein Glücksfall für ihn, als er nach Neubrandenburg in einen höheren Stab als Redakteur berufen wird. Er beginnt ein Fernstudium als Diplomjournalist an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Inzwischen ist er längst glücklich verheiratet. Die Höhen und Tiefen eines Militärjournalisten – die zwingen ihn, vieles neu zu überdenken. Vor allem als einstiger Ausbilder gelingt es ihm, die Probleme der Soldaten immer besser zu verstehen und sie bildhaft zu schildern.
Die spätere Arbeit als Abteilungsleiter in der Wochenzeitung „Volksarmee“ macht ihm nicht nur Spaß, er nimmt auch Stellung gegen Ungereimtheiten, was ihm nach der Entlassung aus dem aktiven Armeedienst und der Tätigkeit als Journalist im Fernsehen der DDR nicht nur böse Blicke einbringt. So fährt er im September 1989 seiner Tochter nach Ungarn hinterher, um herauszukriegen, weshalb sie mit ihrem Partner abgehauen ist; er gibt ihr dabei das Versprechen, sie in keiner Weise als Tochter zu verurteilen. Nach seiner Rückkehr wird er mit einer Parteistrafe gerügt, die Wochen später angesichts der vermeintlichen Verstöße und Fehler durch die Politik nicht mehr relevant scheinen und wieder gestrichen wird. Auf Unverständnis stößt er auch bei seinen Mitarbeitern, als er nach der Teilnahme an der Dokumentarfilmwoche1988/89 in Leipzig angeblich nicht die erwarteten Schlussfolgerungen zieht.
Nach der Wende: Versuche, arbeitsmäßig Fuß zu fassen, u.a in Gran Canaria und in einer Steuerfirma. Die Suche nach Alternativen, günstiger zu wohnen, sowie die Sehnsucht nach Ruhe führt das Ehepaar nach Schweden.
Episoden aus dem Dorfleben und von vielen Begegnungen, so z.B. bei der Geburtstagsfeier einer siebzigjährigen Schwedin, machen den Alltag und die feierlichen Momente in der „Stille“ nacherlebbar. Keine der in der DDR erlebten Widersprüche und politischen Unterlassungssünden wirft den überzeugten Humanisten aus der Bahn, wogegen die Kapitaldiktatur mit ihren hörigen Medien, politische Manipulationen und Lügen im angeblich so demokratischen Deutschland ihn aufbringen – er bleibt ein Suchender!
Henry ist seit der Scheidung der Eltern mit seinen Geschwistern oft alleine. Mama arbeitet im Erzgebirge, zum Vater gibt es keine Kontakte und die Haushälterin Tante Lotte hat andere Sorgen, als die vielen Fragen zu beantworten, besonders die von Henry. Es interessiert ihn, warum wird denn soviel aufgebaut, wenn doch wieder Krieg kommen könnte, wie man im Radio immer hört … Aber er bleibt alleine mit seinen Fragen … Viel später wird er erkennen, mit den Fragen fängt das Denken an.



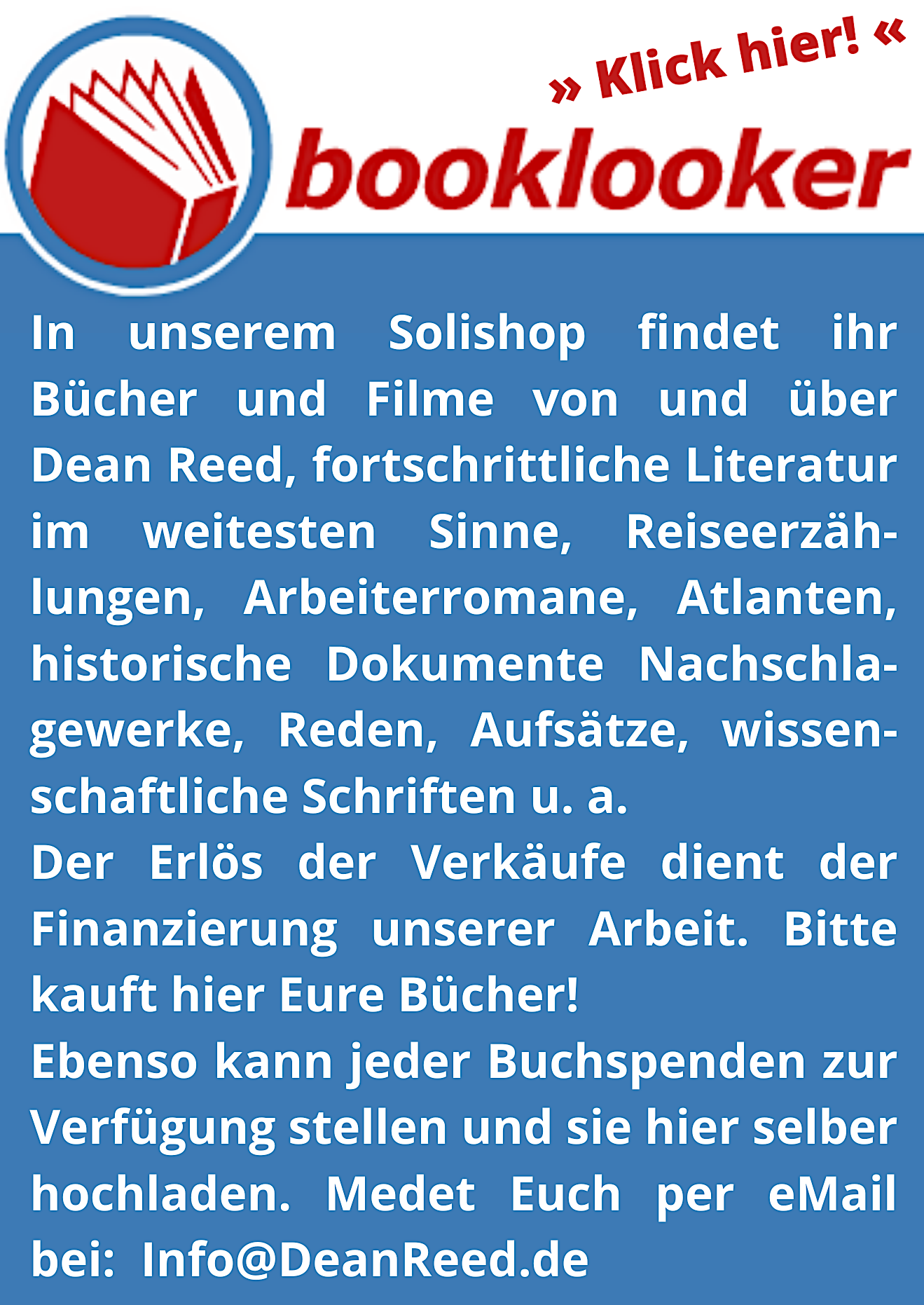














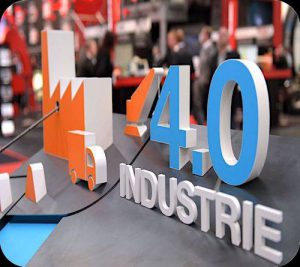













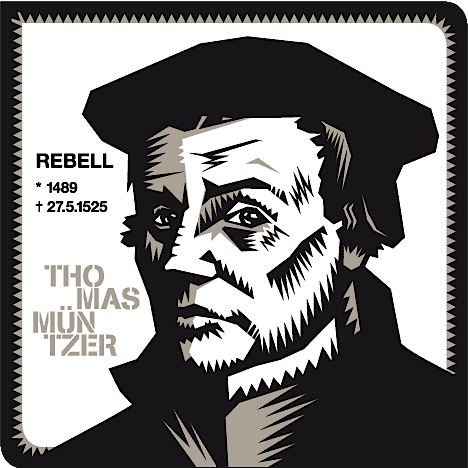


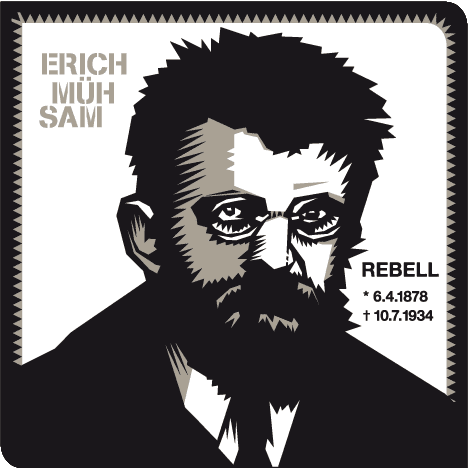
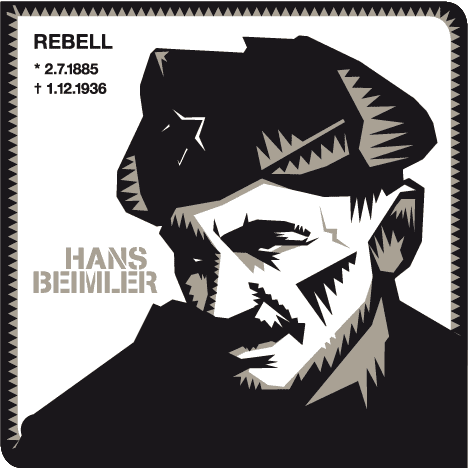


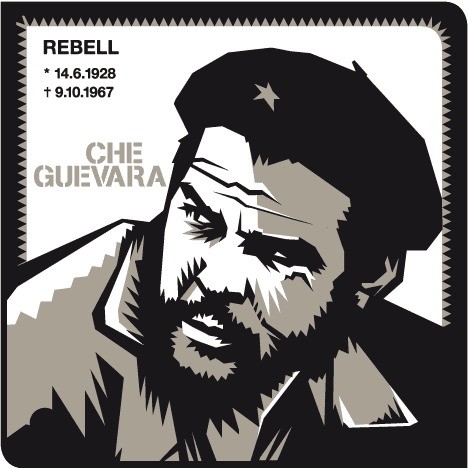
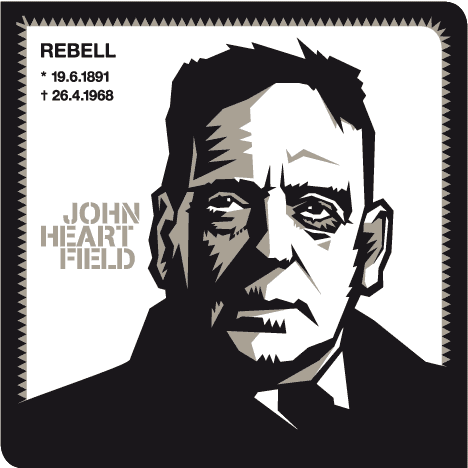

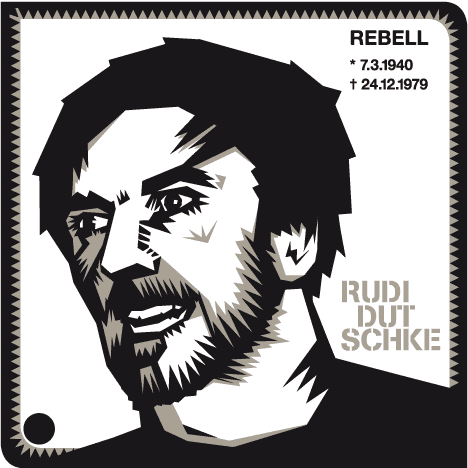
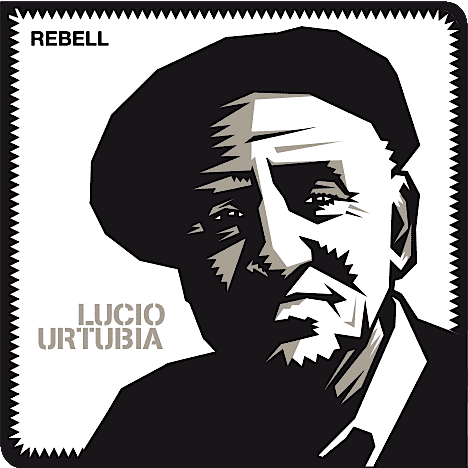

Diskussion ¬